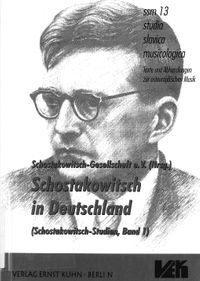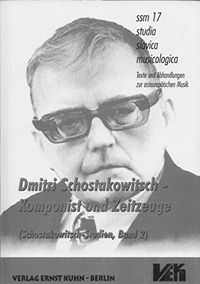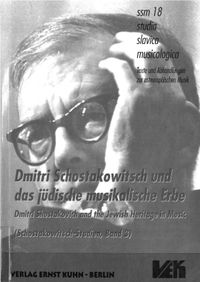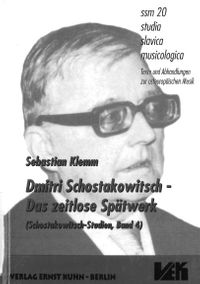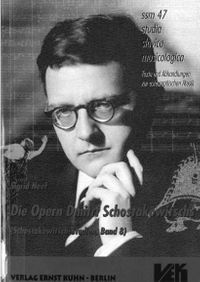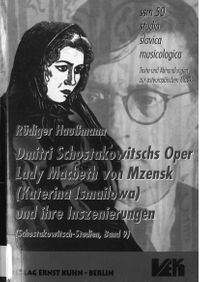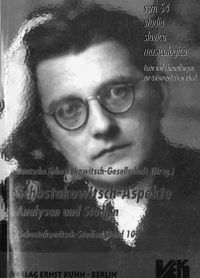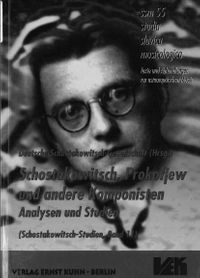Willkommen auf unserer Webseite!
Die Deutsche Schostakowitsch Gesellschaft beschäftigt sich mit der Pflege und Verbreitung des künstlerischen Werkes von Dmitri Schostakowitsch.
Hier finden Sie Informationen über den Komponisten und seine Musik, sowie über die Gesellschaft und ihre Aktivitäten, und Sie können auch Ihre Fragen stellen und Meinungen äußern. Bei uns finden Sie Musikspezialisten und viele Freunde, die die Zuneigung zu Schostakowitsch und seiner Musikwelt zusammengeführt hat.
- Wenn Sie auch Schostakowitsch und seine Musik lieben, werden Sie Mitglied! Wir freuen uns auf Sie! Sprechen Sie uns an: Info@Schostakowitsch.de. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie hier ►
News
„Shostakovich Discoveries“ mit dem ICMA 2026 ausgezeichnet
„Eine der schönsten Hommagen,
die sich ein Künstler wünschen kann“
Das im Mai 2025 bei der Deutschen Grammophon erschienene Album „Shostakovich Discoveries“ umfasst Raritäten und Weltersteinspielungen von Dmitri Schostakowitsch – die meisten davon aufgenommen bei den Internationalen Schostakowitsch Tagen Gohrisch. Die Preisverleihung findet am 18. März 2026 in der Konzerthalle Bamberg statt.
Anlässlich des 50. Todestages von Dmitri Schostakowitsch veröffentlichte die Deutsche Grammophon im Mai 2025 das Album „Shostakovich Discoveries“. Darauf enthalten sind 75 Minuten weitgehend unbekannter Musik von Schostakowitsch, interpretiert von international renommierten Künstlerinnen und Künstlern und zum Großteil live mitgeschnitten bei den Uraufführungen im Rahmen der Internationalen Schostakowitsch Tage Gohrisch. Unter den Raritäten und Weltersteinspielungen finden sich u. a. frühe und mittlere Klavierwerke (Daniil Trifonov, Yulianna Avdeeva, Daniel Ciobanu), ein nachgelassenes Impromptu für Viola und Klavier (Nils Mönkemeyer, Rostislav Krimer), die späte Ballade „Der Nagel von Jelabuga“ für Bass und Klavier in der Vervollständigung von Alexander Raskatov (Alexander Roslavets, Andrei Korobeinikov) und drei nachgelassene Fragmente aus der Oper „Die Nase“ (Staatskapelle Dresden, Thomas Sanderling). Das Album wurde in der Presse vielfach hochgelobt – jetzt wird es in der Kategorie „Premiere Recordings“ mit dem International Classical Music Award (ICMA) 2026 ausgezeichnet.
Der ICMA wird alljährlich von einer 20-köpfigen Jury aus 16 Ländern vergeben und gilt in der Branche als „Klassik-Oscar“. In der Begründung der Jury heißt es: „Ein halbes Jahrhundert nach dem Tod von Dmitri Schostakowitsch ist dieses Album mit Raritäten und weniger bekannten Werken eines der größten Komponisten des 20. Jahrhunderts, gespielt von einer Reihe hochkarätiger Künstler, eine der schönsten Hommagen, die sich ein Künstler wünschen kann. Dieses unverzichtbare Album ist ein Muss in jeder Diskografie des Komponisten der ‚Lady Macbeth von Mzensk‘.“
Der Künstlerische Leiter der Internationalen Schostakowitsch Tage Gohrisch, Tobias Niederschlag, der die Veröffentlichung der „Shostakovich Discoveries“ als Executive Producer betreute, freut sich über die Auszeichnung: „Ich danke unseren Partnern bei der Deutschen Grammophon, die uns für dieses Herzensprojekt von Anfang an größtes Vertrauen geschenkt haben. Dieses wird nun mit diesem wunderbaren Preis belohnt. Danken möchte ich auch allen an dem Album beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, dem Aufnahmeteam um Bernhard Güttler sowie – last but not least – Irina Schostakowitsch, der Witwe des Komponisten, und Dr. Olga Digonskaya, der international führenden Schostakowitsch-Forscherin, die unserem Festival in den vergangenen Jahren immer wieder Neuentdeckungen zur Uraufführung anvertraut haben. Ohne sie wäre dieses Album nicht zustande gekommen.“
Die ICMA-Auszeichnungen werden am 18. März 2026 in Verbindung mit einer Gala der Bamberger Symphoniker unter Jakub Hrůša in der Konzerthalle Bamberg verliehen. Am musikalischen Programm sind für die „Shostakovich Discoveries“ u. a. der Bratschist Nils Mönkemeyer und der Pianist Andrei Korobeinikov beteiligt.
Shostakovich Discoveries – World Premiere Recordings & Rarities
Alexei Mochalov, Alexander Roslavets, bass | Gidon Kremer, Madara Pētersone, violin | Nils Mönkemeyer, viola | Yulianna Avdeeva, Daniel Ciobanu, Andrei Korobeinikov, Rostislav Krimer, Georgijs Osokins, Daniil Trifonov, piano | Andrei Pushkarev, percussion | Kremerata Baltica, Staatskapelle Dresden | Thomas Sanderling, conductor. Deutsche Grammophon (2025).
Mitgliederversammlung wählt Vorstand neu
Dorothea Redepenning ist neue Präsidentin
der Deutschen Schostakowitsch Gesellschaft
Mit runderneuertem Vorstand geht die Deutsche Schostakowitsch Gesellschaft ins 36. Jahr ihrer Vereinsgeschichte. Bei der Mitgliederversammlung am 17. Oktober 2025 wurde die Musikwissenschaftlerin und ausgewiesene Schostakowitsch-Expertin Dorothea Redepenning einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt. Die emeritierte Professorin an der Universität Heidelberg ist langjähriges Mitglied unserer Gesellschaft und vielen Mitgliedern nicht zuletzt durch ihre fundierten Vorträge bei vielen unserer Musikwissenschaftlichen Symposien bekannt. Sie folgt auf den im Februar dieses Jahres unerwartet verstorbenen Publizisten, Operndirektor und Dramaturgen Bernd Feuchtner, der die Deutsche Schostakowitsch Gesellschaft seit 2018 umsichtig und mit großem Engagement geleitet hatte.
Dorothea Redepenning zur Seite steht mit Stefan Weiss, Professor für Historische Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover ein ebenfalls überaus versierter Experte für die russische Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, mit dem sie gegenwärtig an einem umfangreichen Schostakowitsch-Handbuch arbeitet. Wie Stefan Weiss wurde auch Alexander Gurdon einstimmig zum Vizepräsidenten gewählt. Der promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Musik und Musikwissenschaft an der TU Dortmund hat sich nicht nur durch seine brillanten Vorträge bei unseren Symposien einen ausgezeichneten Ruf erworben, sondern war maßgeblich am großen Erfolg der Symposien in Dortmund (2023) und Leipzig (2025) beteiligt. Einstimmig wiedergewählt wurden zudem Reimar Westendorf (Schriftführer) Elisabeth von Leliwa (Schatzmeisterin), sowie Karlheinz Schiedel (Beisitzer; Webseite und Pressearbeit). Den Vorstand komplettiert der Berliner Arzt und Schostakowitsch-Liebhaber Dr. Dietrich Wesemann (Beisitzer).
Dem ausscheidenden Vize-Präsidenten Ronald Freitag, der dieses Amt seit 2018 innehatte und nicht erneut kandidierte, wurde herzlich für sein großes Engagement nicht nur bei der Vorbereitung und Organisation unserer Symposien gedankt. Ein ganz besonderer Dank galt auch Elisabeth von Leliwa, die nach dem Tod Bernd Feuchtners das Amt der Präsidentin kommissarisch übernommen und so unsere Gesellschaft vorbildlich und verantwortungsvoll durch eine alles andere als einfache Zeit geführt hat.
Einig war sich die Versammlung in dem Bestreben, die Zusammenarbeit mit den Internationalen Schostakowitsch Tagen Gohrisch weiter zu vertiefen. So erhofft man sich Synergieeffekte beispielsweise durch künftig gemeinsame Social-Media-Auftritte. Außerdem ist angedacht, unser nächstes Musikwissenschaftliches Symposium im Umfeld des Gohrischer Schostakowitsch-Festivals 2027 stattfinden zu lassen. Tagungsort soll die Musikhochschule Dresden sein. Thematisch plant man, sich schwerpunktmäßig mit der Schostakowitsch-Rezension in der ehemaligen DDR zu beschäftigen. Karlheinz Schiedel
Kurzvorstellungen unserer Vorstandsmitglieder finden Sie hier: ►
Das 22. Musikwissenschaftliche Symposium vom 19. bis 20. in Leipzig
Inhaltsreich und emotional berührend
Von Karlheinz Schiedel
Was für ein magischer Moment! Als die letzten Töne des von Yaroslav Timofeev gefühlvoll interpretierten Klavierstücks „Für Alina“ von Arvo Pärt verklungen waren, herrschte eine Weile absolute Ruhe im Probensaal der Leipziger Musikhochschule „Felix Mendelsohn Bartholdy“. Der russische Musikwissenschaftler widmete seinen Vortrag unserem im Februar verstorbenen Präsidenten Bernd Feuchtner. Ein denkwürdiger Abschluss eines Musikwissenschaftlichen Symposiums, das als eines der erfolgreichsten, inhaltsvollsten, aber auch emotional berührendsten in die Annalen der Deutschen Schostakowitsch Gesellschaft eingehen dürfte. Zeitweise hatten mehr als 120 Musikbegeisterte den Weg in die Grassistraße 8 gefunden, darunter auch viele Mitglieder des Musik-Leistungskurses eines Berliner Gymnasiums. Sie waren gekommen, um den Vorträgen und Analysen von insgesamt 18 hochkarätigen Schostakowitsch-Expert*innen aus dem In- und Ausland zu lauschen und mit ihnen über „Schostakowitsch und seine komponierenden Kollegen“ zu diskutieren.
Das Thema unseres mittlerweile 22. Musikwissenschaftlichen Symposiums erwies sich nicht nur unter musikgeschichtlichen Gesichtspunkten als ungemein ertragreich. Es eröffnete zugleich neue Perspektiven auf eine im Westen oft entweder ignorierte oder als rückständig entwertete sowjetrussische Musikkultur. Und es war ein Herzensthema Bernd Feuchtners, der noch bis kurz vor seinem Tod mit den intensiven Vorbereitungen des Symposiums beschäftigt war, Kontakte zu Referentinnen und Referenten knüpfte und sich um Organisatorisches kümmerte. Nun war es Aufgabe unserer Vorstandsmitglieder Elisabeth von Leliwa, Ronald Freytag und Reimar Westendorf durch das zweitägige Symposium zu führen, die Vortragenden vorzustellen und die Diskussionen zu moderieren. Karlheinz Schiedel würdigte zu Beginn der Veranstaltung das Wirken Bernd Feuchtners. Er habe sich um Schostakowitsch und um die Deutsche Schostakowitsch Gesellschaft große Verdienste erworben.
Und er hätte sich über den Erfolg „seines Kindes“ ganz sicher genauso gefreut wie Tobias Niederschlag. Der künstlerische Leiter des großen Schostakowitsch-Festivals 2025 des Gewandhaus Orchesters, in dessen Rahmen unser Symposium eingebettet war, sprach am Rande der Veranstaltung von einer „gegenseitigen Befruchtung“ und stellte eine intensivere Zusammenarbeit in Aussicht. Man darf gespannt sein.
Einen Bericht in englischer Sprache des britischen Musikwissenschaftlers Gregor Tassie finden Sie hier ►
Neue Schostakowitsch-Website von Jakob Knaus online
Schostakowitschs Sinfonien sichtbar gemacht
Jakob Knaus, in St. Gallen geborener Musikwissenschaftler, Publizist, langjähriger Kultur- und Musikredakteur beim Schweizer Radio DRS2, von 1969 bis 2011 Präsident der Janáček-Gesellschaft und seit einigen Jahren höchst aktives Mitglied unserer Gesellschaft hat nun ein Herzensprojekt zum (vorläufigen) Abschluss gebracht und seine Website mit visualisierten Hörhilfen und sachkundigen Einführungen zu allen 15 Sinfonien Dmitri Schostakowitschs freigeschaltet.
Sehr anschaulich stellt der ausgewiesene Schostakowitsch-Kenner, der schon unsere drei letzten Musikwissenschaftlichen Symposien mit seinen ebenso spannenden wie kenntnisreichen Beiträgen bereichert hat, sämtliche Sinfoniesätze mittels Oszillogramme grafisch dar, wodurch deren akustisch-dynamischer Ablauf unmittelbar sichtbar wird. Zusammen mit zahlreichen Hinweisen zur musikalischen Struktur, zur Zitattechnik, Querverweisen zu anderen Werken, das Aufzeigen „versteckter Motive“ (Internationale, Happy Birthday to you, etc.) und anderes mehr, eröffnen sie nicht nur einen völlig neuen Zugang zum symphonischen Schaffen des Komponisten, sondern stellen sie auch einen wichtigen Beitrag zu einem tieferen Verständnis von Leben und Werk Dmitri Schostakowitschs dar. Unbedingt empfehlenswert! Zur Webseite: ►
Kostenloser Download unserer Schostakowitsch-Studien
|
| |||
Die Deutsche Schostakowitsch Gesellschaft stellt ab sofort die nicht mehr im Buchhandel erhältlichen Bände ihrer Schostakowitsch-Studien zum kostenlosen Download bereit. Die Bände enthalten im Wesentlichen Vorträge, die seit 1992 im Rahmen unserer Musikwissenschaftlichen Symposien von renommierten Musikwissenschaftlern und Musikwissenschaftlerinnen gehalten wurden und stellen einen überaus wertvollen Beitrag zur internationalen Schostakowitsch-Forschung dar. Sie sind zwischen 1998 und 2014 im nicht mehr existierenden Verlag Ernst Kuhn, Berlin erschienen. Durch Anklicken des Titelbildes startet der Download des jeweiligen Bandes. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Übersichtsseite. ►
Zu unserem News-Archiv: