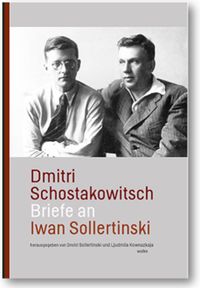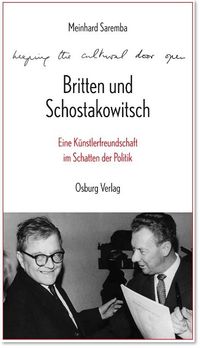Bücher
Jeremy Eichler bringt Meisterwerke aus bösen Zeiten zum Reden
Schostakowitschs Musik als Mahnmal
Von Bernd Feuchtner
Dieses Buch überrascht. Nicht unbedingt der Titel. „Der Klang der Zeit“ war ein großartiges Buch über Rassismus im US-amerikanischen Musikleben, „Der Lärm der Zeit“ war 2001 eine raffinierte Schostakowitsch-Performance von Simon McBurney beim Londoner „Theatre de Complicite“. Deren Titel kaperte später der Schriftsteller Julian Barnes für sein Schostakowitsch-Buch. Nun also „Das Echo der Zeit“. Wer die Entstehungsgeschichten von Schönbergs „Überlebendem aus Warschau“, den „Metamorphosen“ von Richard Strauss, Brittens War Requiem und Schostakowitschs Babi-Jar-Sinfonie kennt, wird sich etwas mühsam durch deren manchmal recht trockene Nacherzählung kämpfen. Aber wer kennt das schon?
Eichler holt weit aus und stellt Bezüge her, die diese Kunstwerke aufleuchten lassen. Er beginnt mit der Goethe-Eiche („Hier fühlt man sich groß und frei ..., und wie man eigentlich immer sein sollte,“ soll Goethe, an diesen Baum gelehnt, gesagt haben). Und die taucht plötzlich im KZ Buchenwald bei der Fälschung von Schillers Schreibtisch durch Häftlinge (noch heute in der Gedenkstätte zu sehen) wieder auf. Was ist aus Goethes humanistischem Lebensgefühl geworden, was aus dem Pathos von Beethovens Neunter und Mahlers Achter?
Große Kunstwerke bringen uns ferne Zustände ganz nah, bewahren deren Kern, wenn alle Erinnerung längst verflogen ist. Und zwar dann, wenn wir sie mit den menschlichen Empfindungen konfrontieren, die in sie eingegangen sind. Das Schicksal Arnold Rosés, des gefeierten Konzertmeisters der Wiener Philharmoniker, der ebenso zur Emigration gezwungen wurde wie sein Schwager Arnold Schönberg, während seine Tochter Alma Rosé das Mädchenorchester in Auschwitz leiten musste – diese jüdischen Schicksale leiten in die Erzählung der geglaubten Emanzipation von Musikern wie Felix Mendelssohn Bartholdy und diese wiederum in die Erzählung des Schicksals von dessen Denkmal, das von stolzen Leipziger Bürgern errichtet, von Leipziger Nazis zerstört und von Leipzigern wiedererrichtet wurde. Und aus alledem entsteht die Erzählung von Schönbergs Auseinandersetzung mit seinem Judentum, seiner Moses-Oper und seines „Survivor of Warsaw“.
Auch Richard Strauss und seine zwielichtige Rolle im Nazireich, seine opportunistische Haltung gegenüber seinem jüdischen Librettisten Zweig, seine snobistische Trauer über „seine“ zerstörten Opernhäuser wird geschärft im Blick auf sein bequemes Dasein, auf die Niedertracht – und später Verstocktheit – der Garmischer Bevölkerung, was wiederum mit deren Umgang mit dem Grabmal des großen Dirigenten und Münchner GMD Hermann Levi zusammenpasst. Es sind solche Bezüge, die die Lektüre dieses Buches zu einem großen Gewinn machen. Eichler zeigt Momente, die Schnappschüsse der Erinnerungskultur geworden sind.
Das letzte Kapitel gruppiert sich um Schostakowitschs 13. und 14. Sinfonie und beginnt mit dem Überfall der Hitler-Truppen auf die Ukraine, die sofort mit der Vernichtung jüdischen Lebens begannen. Deren Höhepunkt war bekanntlich Babyn Jar. Zwei jüdische Schriftsteller wurden zu Chronisten des Krieges: Ilja Ehrenburg und Wassili Grossman. Das Schicksal der beiden ist zugleich das Schicksal der unterdrückten Wahrheit. Und hier kommt Schostakowitsch ins Bild, samt den Verdikten gegen ihn von 1936 und 1948. „In diesem Sinne hat man seine fünfzehn Sinfonien als ‚das geheime Tagebuch einer Nation‘ bezeichnet,“ zitiert er Taruskin. Über Anna Achmatowa springt er zur Uraufführung der Leningrader Sinfonie (aber nur von ihrer politischen Wirkung her) und zum Jüdischen im 2. Klaviertrio sowie Stalins Antisemitismus.
Beeindruckend dann die Schilderung von Eichlers Besuch in der Schlucht von Babyn Jar und von der Dreizehnten Sinfonie, beides wiederum eingebettet in die politischen Umstände des Gedenkens an den Massenmord wie der Uraufführung der Sinfonie. Aber auch im abschließenden 10. Kapitel „Denkmäler“ kommt er wieder auf Schostakowitsch zu sprechen, nämlich auf die Vierzehnte Sinfonie, die Eichler als geheimes Requiem versteht: „Durch die Verwendung und Wiederbelebung von Stimmen von Dichtern, die selbst auf unterschiedliche Weise Opfer des modernen Kriegs waren, illustriert die Vierzehnte gekonnt, wie Kunstwerke sich an andere Kunstwerke erinnern können, indem sie eine Art innewohnender Chronik bilden.“
Jeremy Eichler: Das Echo der Zeit. Die Musik und das Leben im Zeitalter der Weltkriege. Aus dem Amerikanischen von Dieter Fuchs. Klett-Cotta 2024, 463 S., € 32
Julian Barnes' Schostakowitsch-Roman „Der Lärm der Zeit“
Von beklemmender Aktualität
Immer wieder inspirieren Leben und Werk Dmitri Schostakowitschs Schriftsteller in aller Welt zu dichterischer Auseinandersetzung. Zuletzt waren es die beiden Amerikaner William T. Vollmann mit seinem epochalen Roman „Europe Central“ und Richard Powers mit seinem die musikalische Avantgarde durchleuchtenden „Orfeo“, sowie die in Berlin lebende Neuseeländerin Sarah Quigley mit „Der Dirigent“, die dem großen Russen ein literarisches Denkmal setzten.
Auch „The Noise Of Time“, der Ende Januar 2016 auf Englisch erschienene neue Roman von Julian Barnes, rückt Schostakowitsch ins Zentrum, wobei sich der britische Erfolgsautor besonders mit den für den Komponisten ebenso dramatischen wie schicksalsschweren Ereignissen der Jahre 1936/37, 1948 und 1960 beschäftigt. Das englischsprachige Feuilleton ist voll des Lobes: „A masterpiece of biographical fiction“, urteilt Alex Preston im „Observer“, „A compelling novel about art and power, courage and cowardice, and the capriciousness of fate…” resümiert Sebastian Shakespeare im „Tatler”.
Endlich, ein Jahr nach dem englischen Original, ist Julian Barnes großartiger Schostakowitsch-Roman „Der Lärm der Zeit“ auch auf Deutsch erschienen. Der britische Erfolgsautor, der im vergangenen Jahr für sein Lebenswerk mit dem begehrten Siegfried-Lenz-Preis ausgezeichnet wurde, setzt sich in seinem neuen Werk ebenso kenntnisreich wie einfühlsam mit dem Leben des großen russischen Komponisten auseinander. Die Fragen, die er dabei aufwirft, sind – wie immer, wenn es um Schostakowitsch geht – existenziell: Wie steht es um moralische Integrität, um persönlichen Mut und menschliche Aufrichtigkeit, um künstlerische Wahrhaftigkeit in einer von staatlicher Repression vergifteten Wirklichkeit? Tiefdunkle, längst überwundene, gewissermaßen abgehakte Vergangenheit? In einer Zeit, in der einmal mehr Künstler, Intellektuelle, Wissenschaftler, Journalisten, Andersdenkende von egomanischen Autokraten und nach Macht gierenden Populisten mit beängstigender Aggressivität als Volksfeinde“ denunziert werden, ist Barnes biografischer Künstlerroman von geradezu beklemmender Aktualität.
Eine ausführliche Besprechung dieses bemerkenswerten Buches finden Sie hier: ►
Briefe an Iwan Sollertinski
Dmitri Schostakowitsch ohne Maske
Nirgends zeigt sich der große sowjetrussische Komponist Dmitri Schostakowitsch so unverstellt wie in den Briefen an seinen besten Freund Iwan Sollertinski, den klügsten Musikwissenschaftler Russlands. Kennengelernt hatten sie sich in Sankt Petersburg (damals Leningrad), als Schostakowitsch 20 war und Sollertinski 24. Beide klebten sofort aneinander wie die Kletten. Und wenn sie getrennt waren, schrieben sie sich Briefe oder Postkarten. Nur die von Schostakowitsch sind erhalten. Sie geben das Bild zweier brillanter junger Künstler, die sich mit Begeisterung in die aktuellen Auseinandersetzungen stürzen und dabei nicht vergessen, das Leben zu genießen. Auch so intim erleben wir Schostakowitsch sonst nirgends. Ab 1935, mit dem Stalin’schen Terror, verändert sich die Tonlage allmählich. Die beiden sind sich nicht mehr so sicher, dass Können und Argumente sich durchsetzen. Der Überfall der Deutschen auf die Sowjetunion und die Einkreisung Leningrads durch die Nazitruppen trennt die Freunde: Schostakowitsch wird nach Samara (damals Kuibyschew) evakuiert, Sollertinski nach Nowosibirsk. Ein gutes Ende scheint auf, als Schostakowitsch 1943 nach Moskau zieht und dem Freund eine Professur am Moskauer Konservatorium vermittelt. Doch der durch Kriegsentbehrungen und Mobbing in der Leningrader Philharmonie geschwächte Sollertinski erliegt 1944 mit 41 Jahren einem Herzschlag. Für Schostakowitsch war das eine Katastrophe. Seine Briefe bilden ein Monument für eine große Freundschaft und geben intime Einblicke in die kulturpolitische Entwicklung der Sowjetunion.
Jetzt endlich sind die von Dmitri Sollertinski und Ljudmila Kownazkaja herausgegebenen Sollertinski-Briefe Schostakowitschs in deutscher Übersetzung von Ursula Keller und mit einem Vorwort von Bernd Feuchter, dem Präsidenten der Deutschen Schostakowitsch Gesellschaft, versehenen Ausgabe im Wolke Verlag erschienen. Das Buch (251 Seiten, Paperback., € 36.–, ISBN: 978-3-95593-097-4) ist überall im Buchhandel erhältlich.
Zeugnisse aus eisiger Zeit – Eine Rezension von Jakob Knaus erschien in der Schweizer Musikzeitung 1_2/2022: ►
Hinter Fassade und Fälschung – Eine Rezension von Christoph Schlüren in der nmz 3/2023: ►
Meinhard Saremba: Britten und Schostakowitsch
Eine Künstlerfreundschaft im Schatten der Politik
Nach den Büchern zu Elgar/Britten (1994), Janáček (2001) und zu Clara Schumann/ Johannes Brahms (2021) legt nun der deutsche Musikwissenschaftler Meinhard Saremba ein weiteres Komponisten-Doppelporträt vor: zu Britten und Schostakowitsch. Das Wagnis hat sich gelohnt, die beiden aus dem Schatten der Politik zu holen, den englischen Komponisten, Benjamin Britten (1913-1976), in der Zeit des Niedergangs eines Weltreiches und den russischen, Dmitri Schostakowitsch (1906-1975), in der schreckenerregenden Sowjetzeit. Die 1960 eher zufällig sich ergebende Bekanntschaft, welche über die zeitweise schier unüberwindliche Grenze des Kalten Krieges hinweg zur Freundschaft werden konnte, wird in den verschiedensten Facetten von künstlerischen und menschlichen Bezügen dargestellt; allen Widerwärtigkeiten zum Trotz konnten sie sich sechsmal treffen, sowohl in Aldeburgh wie in Moskau, als auch auf der gemeinsamen Reise in Armenien (Sommer 1965).
Lesen Sie hier die vollständige Rezension von Jakob Knaus ►
Rudolf Barschai zum Gedenken
Am 2. November 2015 jährt sich zum fünften Mal der Todestag des großen Dirigenten Rudolf Barschai. Rudolf Barschai verband eine tiefe Freundschaft mit Dmitri Schostakowitsch, dessen Symphonie Nr. 14 er mit seinem Moskauer Kammerorchester am 29. September 1969 in Leningrad uraufführte. Legendär sind seine einfühlsamen und authentischen Bearbeitungen von Kammermusikwerken von Dmitri Schostakowitsch und Serge Prokofjew. Seine 1999 erschienene Gesamteinspielung der Schostakowitsch-Symphonien mit dem WDR Sinfonieorchester wurde von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeiert. In Anerkennung seiner großen Verdienste um die Verbreitung und Popularisierung der Werkes Dmitri Schostakowitschs verlieh im die Deutsche Schostakowitsch Gesellschaft die Ehrenmitgliedschaft. In diesem Herbst rückt das Leben und Wirken Rudolf Barschais durch zwei Neuveröffentlichung in den Fokus der Musikwelt. Das Label ICA-Classics widmet ihm und seinem Schaffen eine 20-CD-Box „A Tribute To Rudolf Barshai“, die ab November 2015 im Handel erhältlich sein wird und der deutsche Musikwissenschaftler und Schostakowitsch-Kenner Bernd Feuchtner (Dmitri Schostakowitsch – „Und Kunst geknebelt von der groben Macht“) macht mit einem neuen Buch: „Rudolf Barschai – Leben in zwei Welten: Moskaus goldene Ära und Emigration in den Westen“ von sich reden. Rudolf Barschai und das Moskauer Kammerorchester unter seiner Leitung standen zwei Jahrzehnte lang weltweit für Musik auf höchstem Niveau. Als Bratschen-Virtuose musizierte er mit Swjatoslaw Richter, David Oistrach, Emil Gilels, Mstislaw Rostropowitsch, Mieczysław Weinberg, Dimitri Schostakowitsch. Doch dann ertrug er die Schikanen der Sowjetbürokratie nicht länger, emigrierte in den Westen und machte als britischer Staatsbürger eine zweite Karriere als Interpret großer Sinfonik. In zahlreichen Gesprächen mit Bernd Feuchtner erzählte Rudolf Barschai sein bewegtes Leben in diesen beiden Welten – das Bekenntnis eines klugen Musikers, der Bericht eines wachen Zeitzeugen, ein Stück russischer Literatur. Zur Website des Verlags: ►
Michael Jurowski – Dirigent und Kosmopolit
Michail Jurowski, der 1945 in Moskau geborene Dirigent und Kosmopolit, gehört zu den wichtigsten Schostakowitsch-Interpreten weltweit. Den Internationalen Schostakowitsch-Tagen in Gohrisch ist Jurowski, der seine Karriere Ende der 60er Jahre als Assistent von Gennadi Roschdestwenski beim Großen Sinfonieorchester des Staatlichen Rundfunks und Fernsehens der UdSSR in Moskau begann, in besonderer Weise verbunden. Beim Eröffnungskonzert der Festival-Premiere sprang er für den erkrankten Rudolf Barschai ein, 2012 wurde er für sein vielfältiges Engagement und künstlerisches Wirken mit dem Schostakowitsch Preis Gohrisch ausgezeichnet. Kurz vor seinem 70. Geburtstag sind nun die Lebenserinnerungen des großen Dirigenten erschienen. In Gesprächen mit Michael Ernst erinnert er sich an seine frühen Begegnungen mit den Größen des sowjetischen Kulturlebens, an den Alltag in der Diktatur und den Neuanfang im Westen, unter anderem in Berlin (Komische Oper), Dresden (Semperoper), Leipzig (Opernhaus) und Köln (WDR Rundfunkorchester). Er reflektiert Fragen zu Judentum und Politik sowie nicht zuletzt zur Musik in all ihren Facetten.
Über die kürzlich erschienene Autobiographie und einige neue Entwicklungen rund um die Schostakowitsch Tage Gohrisch berichtet die Sächsische Zeitung. ►
Jüdische Musik in der Sowjetunion – ein Tagungsband über den Komponisten Alexander Weprik
„Hier macht man Musik wie Druckbleistifte“
Von Bernd Feuchtner
Alexander Weprik (1899-1958) wurde sein Judentum erst zur schöpferischen Quelle, dann aber zum Verhängnis, einem Schostakowitsch-Zeitgenossen, der wie dieser in der frühen Sowjetunion mit Begeisterung am Aufbau einer neuen Musikkultur mitarbeitete. Er galt als große Hoffnung der sowjetischen Musik, hatte internationale Erfolge und gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Gesellschaft für jüdische Musik, die aus der jiddischen Folklore neue Energie für die Musik zu ziehen hoffte.
Nachdem seine Musik schon beim Göttinger Symposium „Composers in the Gulag under Stalin“ 2010 großen Eindruck gemacht hatte, war ihm am 8. Dezember 2018 in Hannover ein eigenes Symposium gewidmet, dessen Beiträge im hochinteressanten Band 18 der „Jüdische Musik“-Studien erschienen sind. Mehr ►
Die Lebenserinnerungen eines großen Bratschisten
Fjodor Serafimowitsch Druschinin (1932 - 2007) verband eine lebenslange Freundschaft mit Dmitri Schostakowitsch. Der russische Bratschist und Komponist studierte am Moskauer Konservatorium bei Wadim Borissowski, dessen Platz im legendären Beethoven Streichquartett er ab 1964 einnahm. Das Beethoven Quartett hat fast sämtliche Streichquartette Schostakowitschs uraufgeführt, als Dank und Anerkennung für die langjährige künstlerische Zusammenarbeit und zum Zeichen der tiefen persönlichen Freundschaft hat Schostakowitsch einige seiner Quartette den Mitgliedern des Beethoven Quartetts gewidmet. Fjodor Serafimowitsch Druschinin ist zudem Widmungsträger von Schostakowitschs letztem Werk, der Sonate für Viola und Klavier op. 147. Die Association Internationale „Dimitri Chostakovitch“ Paris legt nun erstmals die englische Übersetzung der Lebenserinnerungen dieses bedeutenden Künstlers und Wegbegleiters Schostakowitschs vor. Das Buch ist ausschließlich per Bestellung bei der Association Internationale „Dimitri Chostakovitch“ erhältlich und kostet 30 Euro (inkl. Porto). Bestellungen per E-Mail an:
Emmanuel.Utwiller@chostakovitch.org